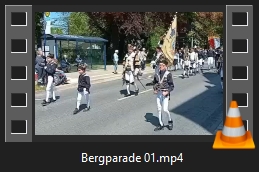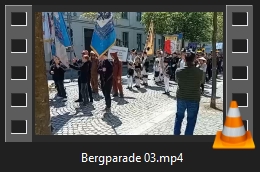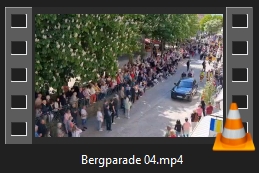Vorwort:
Aus der Geschichte der Eisleber Bergschule von 1798 – 1928 können wir entnehmen, dass unter der Matrikel-Nr.168 und 169 des Jahres 1829 zwei später sehr erfolgreiche Bergbeamte ihr Studium absolvierten – Johann Gottlieb Röhrig und Krug von Nidda. Die Bergschüler waren damals angehalten über ihre Studienzeit Tagebuch zu führen, die heute noch zum Teil im Museum der Bergschule aufbewahrt werden. Die grundlegenden Informationen der nachfolgenden Geschichte von Dr. Rudolf Mirsch aus den Weihnachtstagen des Jahres 1829, entstammen dem Tagebuch des Bergschülers Johann Gottlieb Röhrig.
Heute ist der 24. Dezember des Jahres 1829, Heiligabend. Wie lange habe ich diesen Tag herbeigesehnt! Mein letzter kurzer Besuch bei der Mutter in Wettelrode ist schon mehr als vier Wochen her. Inzwischen ist der Winter immer deutlicher mit Kälte und Schnee ins Land gezogen. Die sonntäglichen Gottesdienste haben bereits eine weihnachtliche Stimmung verbreitet. Die Sehnsucht, bald wieder im Heimatort, bei der Mutter und den alten Freunden zu sein, ist von Tag zu Tag stärker geworden. |

Die Unterrichtsstunden heute verlangen aber noch einmal meine volle Aufmerksamkeit. Dann endlich wünscht uns der Schichtmeister, unser Lehrer Herr Plümicke, ein gesegnetes Weihnachtsfest und gesunde Feiertage und gibt damit gleichzeitig die Erlaubnis, eine Woche nach Hause reisen zu dürfen.
Um 14 Uhr verlasse ich mit meinem neuen Schulfreund aus Sangerhausen, Otto Krug von Nidda, die Schulstadt Eisleben. Otto ist zwei Jahre jünger als ich und noch nicht lange in unserer Klasse. Er hat die Landesschule in Pforta besucht und konnte wegen seiner guten Vorbildung gleich in die Oberstufe aufgenommen werden. Wir stellten bald fest, dass wir uns gut ergänzten. Manche Stunde der Unterrichtsvorbereitung verbrachten wir nun zusammen. Meine Stärken liegen in der Praxis, seine in der Theorie.
Wir haben einen langen, gemeinsamen Fußmarsch vor uns und viel Zeit, auch über persönliche Dinge zu sprechen. Die letzten Häuser von Eisleben liegen bald hinter uns. Zuerst tauschen wir noch unsere Gedanken aus über die Aufgabe, die wir bereits gestern am 23. Dezember bekommen haben. In den Weihnachtsferien sollen wir eine Disposition zur Beschreibung des neuen Heinrich-Schachtes in den vereinigten Mohrunger und Kuhberger Revieren erarbeiten und vorlegen. Unsere Lehrer sind streng und verlangen viel von uns. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt an der Bergschule lernen kann.
Es ist eine besondere Stimmung um uns herum, die Dämmerung bricht langsam herein, es ist ruhig auf der Straße, wir sind voller Vorfreude auf den Weihnachtsabend. Ich kann jetzt auch ein wenig mehr über meine Familie und mich erzählen.
Otto weiß bereits, dass mein Vater nicht mehr lebt. Ich erzähle ihm nun, dass am 2. Oktober 1819 meiner Mutter die traurige Nachricht überbracht wurde, dass mein Vater auf dem Alexanderschacht verunglückt sei und nie mehr heimkommen wird. Wie sollten wir ohne den Vater leben? Die Not war überall zu spüren. Ich war ja noch ein Schulkind und besuchte die Dorfschule in Wettelrode. Um die Armut zu lindern, fuhr ich als 16-Jähriger als Bergjunge in die Grube ein und erlernte den Beruf eines Bergmanns. Meine Mutter und ich sind sehr dankbar dafür, dass uns die Sangerhäuser Gewerkschaft nicht vergessen hat. Sie zahlt wöchentlich 15 Groschen, womit die Voraussetzung erfüllt ist, dass ich die Bergschule in Eisleben besuchen kann.
Ich möchte niemanden enttäuschen und alle Aufgaben zuverlässig und in guter Qualität erfüllen. Ob mein Freund versteht, was es mir bedeutet, hier lernen zu können?
Es wird langsam dunkel auf der Straße. Auf unserem Weg durch Blankenheim sehen wir milden Kerzenschein hinter den Fenstern flackern, und jeder von uns hängt seinen eigenen Gedanken nach. Ich sehe schon zu Hause die Mutter vor mir, wie sie geschäftig meinen Besuch vorbereitet. Ich glaube, sie ist sehr stolz darauf, dass ich ein guter und strebsamer Schüler bin und nicht nur das Vertrauen der Betriebsbeamten der Reviere bei Wettelrode rechtfertige, die mich etwa vor Jahresfrist zum Schulbesuch ermunterten. In den zurückliegenden Monaten absolvierte ich in den Eisleber Revieren mit Fleiß und bergmännischem Geschick die Arbeitsschichten und erreichte auch gute Leistungen in der Schule.
Auf unserem Weg kommen wir auch auf das Examen zu sprechen, das am 6. November an der Bergschule von den Bergschülern abgelegt werden musste, um von der zweiten in die erste Klasse versetzt zu werden. Was waren wir aufgeregt! Unsere Lehrer stellen sehr hohe Forderungen und ahnden kleinste Fehler und Nachlässigkeiten.
Musste ich doch erst drei Tage zuvor, am 3. November, eine Probearbeit noch einmal abschreiben, weil sie meinem Schichtmeister Herrn Plümicke nicht gut genug war. Ärgerlich war ich vor allem auch darüber, dass ich deswegen eine Schicht nicht anfahren konnte und so auch ein Schichtlohn ausgefallen ist.
Wegen der Prüfung war ich zwar zuversichtlich, aber wer ist schon völlig sicher? Alle Zweifel und Sorgen waren vorbei, als mir bereits drei Tage nach dem Examen Herr Obersteiger Eisentraut mitteilte, dass ich das Examen bestanden hatte und nun in der ersten Klasse weiter lernen durfte. |

Otto erzählt mir auch von seiner Schulzeit an der Landesschule Pforta bei Naumburg. Ich erfahre von ihm, dass das eine bekannte große Internatsschule ist, deren Tradition bereits bis in das 16. Jahrhundert zurückreicht. In der ehemaligen Klosteranlage der Zisterzienser aus dem 12. Jahrhundert werden begabte Knaben auf ein Universitätsstudium vorbereitet, und die Anforderungen sind auch entsprechend hoch. Nun lernt Otto also hier an unserer Bergschule, die auch einen guten Ruf hat. Ich mache mir so meine Gedanken, frage ihn aber nicht weiter nach seinen Beweggründen.
Nun ist es inzwischen ganz dunkel geworden. Wir schreiten zügig vorwärts. Emseloh liegt bereits hinter uns, und wir kommen bald nach Riestedt. Hier trennen sich unsere Wege. Otto will weiter nach Sangerhausen, ich werde die Abkürzung über Gonna nach Wettelrode laufen. Der Abschied ist kurz, wir möchten nun schnell zu Hause sein. Jeder freut sich auf seine Familie, eine warme Stube und ein gutes Essen. Wir verabschieden uns mit einem festen Händedruck und guten Wünschen für den Heimweg und die kommenden Tage.
Nach kurzer Zeit verklingen die Schritte des Schulkameraden, ich bin allein.
Es ist dunkel, aber mir ist nicht bange, bin ich doch erst vor kurzem diesen Weg gegangen. Ich versuche, mich so genau wie möglich daran zu erinnern. Und so führen mich meine Gedanken zurück zu den Geschehnissen der vergangenen Wochen.
Es war nach dem Lohntag am 14. November, als ich den Weg zum letzten Mal ging, denn die Lehrer und die Grubenofficianten hatten mir die Genehmigung erteilt, meine Angehörigen in Wettelrode zu besuchen. Der Urlaub wurde gegeben, weil nach dem Examen einige Tage kein Unterricht stattgefunden hatte. Ich weiß noch sehr genau, wie viel Geld ich in den fünf Wochen der ersten Lohnung des Quartals Luciae ausgezahlt bekommen habe. Für die 27 verfahrenen Arbeitsschichten wurden mir bei einem Schichtlohn von 7 Silbergroschen und 9 Pfennigen insgesamt 6 Reichsthaler, 29 Silbergroschen und 3 Pfennige ausgezahlt.
Die Zeit im heimatlichen Dorf war schön, auch wenn ich eigentlich nur einen Tag Urlaub hatte. Meine Vorgesetzten in Eisleben hatten mir umfangreiche Aufträge erteilt, die ich von hier aus erfüllen sollte. So war ich bereits am nächsten Tag auf der Kupferhütte in Sangerhausen und anschließend beim Faktor Falke in Grillenberg. Mit Fahrsteiger Brathuhn befuhr ich einige Schächte in der Umgebung. Sehr interessant war auch für mich der Besuch des Pochwerkes, wo man mit dem Wasserabführungsgraben und dem Bau des Gebäudes begonnen hatte. Ich war damals sehr froh, dass ich alle Aufträge zur Zufriedenheit erfüllen konnte.
Ich konzentriere mich wieder voll auf meinen Weg. Leider ist heute keine klare Winternacht, aber ich bin sicher, dass ich die richtige Abkürzung genommen habe.
In einer halben Stunde bin ich in Gonna, dann noch eine Stunde, und ich bin zu Hause bei der Mutter. Sie wartet bestimmt schon auf mich. Diese Gedanken beflügeln meinen Schritt. Noch bin ich überzeugt davon, dass der schmale Weg, den ich vor mir erahne, nach Gonna führt. Doch allmählich kommen mir Zweifel. Müsste ich nicht längst diesen Ort erreicht haben oder täuscht mich mein Zeitgefühl? Es ist Heiligabend, es gibt keine Hoffnung, dass ich einem anderen Menschen hier begegnen könnte. Noch verdränge ich den Gedanken, dass ich mich verlaufen haben könnte. Aber so angestrengt ich auch schaue, in der Dunkelheit finde ich keinen Baum, keine Stelle, die mir bekannt ist. Ich bin allein, ich friere. Was soll ich machen, wohin soll ich gehen? Eines weiß ich: Vor allem darf ich jetzt nicht verzagen. Ich muss weiter laufen, um nicht zu erfrieren. Ich mache mir selber Mut. Ich bin jung und gesund und ich werde nach Hause kommen. Und so laufe ich weiter und weiter. Auch nach zwei Stunden ist alles noch fremd um mich her. Ich unterdrücke die Angst, die in mir aufsteigt. Die Mutter wird sich auch Sorgen machen, müsste ich doch schon längst in Wettelrode sein. Und so halte ich an der Hoffnung fest, dass es für mich ein gutes Ende geben wird.
Dann nach einer weiteren Stunde in der Dunkelheit und der kalten Stille, in der ich nur das Geräusch der eigenen Schritte höre und sonst nichts, komme ich an eine Stelle, die mir bekannt ist. Jetzt weiß ich, dass ich bald zu Hause bin. Ein Gefühl der Freude überkommt mich, die Spannung fällt langsam von mir ab, ich spüre aber auch, dass ich sehr müde bin. Nun wird alles gut.
Die Mutter empfängt mich mit Tränen in den Augen. Ich umarme sie und bin einfach nur glücklich, dass ich wieder hier bei ihr bin. Bis an mein Lebensende werde ich diese lange, einsame Wanderung an diesem besonderen Weihnachtsabend nicht vergessen.
|
*****
Johann Gottlieb Röhrig (* 22. Juli 1808, + 27. März 1875), verdienstvoller Bergmann, Obersteiger (1841), Berggeschworener (1857). Namensgeber des Röhrigschachtes in Wettelrode
Otto Ludwig Krug von Nidda (* 16. Dezember 1810 in Sangerhausen, + 03. Februar 1885 in Berlin), Geheimer Oberbergrat (1856), Leiter der Abteilung für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen, 1865 Oberberghauptmann.
Karl Friedrich Ludwig Plümicke (* 06. März 1791, + 27. April 1866), verdienstvoller Lehrer an der Bergschule in Eisleben, Schichtmeister am Froschmühlen- und Erdeborner Stollen, Stollenfaktor, Bergrat, Ehrenbürger der Stadt Eisleben.
Johann Christ. Eisentraut (* 07. Februar 1772, + 09. Dezember 1830), Obersteiger, 2. Lehrer. |
|









 18. Barbarafeier unseres Vereins und des Traditionsvereins Bergschule e.V.
18. Barbarafeier unseres Vereins und des Traditionsvereins Bergschule e.V. 2. Haldenbesteigung am Fortschrittschacht
2. Haldenbesteigung am Fortschrittschacht Aufbau, Übergabe und Einweihung